Meine Realität mit Autismus, Trans-Sein und Beziehungssuche

Leben auf zwei Frequenzen
Es gibt Tage, da wache ich auf und fühle mich, als wäre ich schon am Ende. Nicht, weil der Tag schon passiert ist, sondern weil ich innerlich „selig tot“ bin. Es ist eine Art von Erschöpfung, die nicht nur vom Schlaf abhängt. Autismus bedeutet, dass die Welt mir nie neutral begegnet. Geräusche, Lichter, Bewegungen, Stimmen – alles ist zu viel, alles schneidet tiefer. Ich brauche Routinen, Strukturen, Rückzugsorte, um überhaupt durch den Tag zu kommen. Aber Routinen allein retten nicht, wenn die Grundenergie fehlt.
Als Transfrau trage ich gleichzeitig eine andere Form der Last: die ständige Unsicherheit, ob ich gesehen oder verletzt werde. Ein Blick, ein Kommentar, eine falsche Ansprache und der Tag kippt. Diese kleinen Nadeln summieren sich, bis ich wieder an dem Punkt bin, wo nichts mehr geht. Ich existiere dann zwar, aber ich lebe nicht. Ich lächle vielleicht nach außen, organisiere Demos, schreibe Texte, halte Reden. Aber innen herrscht Stille, ein Gefühl, schon vor dem Abend am Ende zu sein.
Diese Kombination macht, dass ich mich wie zwischen zwei Fremdsprachen bewege, die ich täglich übersetzen muss. Die eine Sprache ist meine Wahrnehmung – immer zu intensiv, immer aufgeladen, immer kurz vor Überlastung. Die andere ist die gesellschaftliche Wahrnehmung von mir – immer skeptisch, immer prüfend, oft feindselig. Beides gleichzeitig zu tragen, nimmt mir so viel Kraft, dass mir ausgerechnet das, was mir am meisten guttun würde – Nähe, Intimität, Beziehung – wegen meiner Identität oft fehlt und mich nur noch tiefer in die Krise stürzt.
Zwischen Frauenfreundschaften und Beziehungslosigkeit
Frauenfreundschaften sind mein Rettungsanker. Sie sind das Netz, das mich hält, wenn ich selbst nicht mehr kann. Sie geben mir einen Ort, an dem ich verstanden werde, ohne alles erklären zu müssen. Aber genau darin liegt auch die bittere Wahrheit: sie bleiben oft Freundschaften und nicht mehr. Ich habe gelernt, mich zu freuen, wenn ich mit Frauen in Verbindung stehe, die mich ernst nehmen, die meine Eigenheiten nicht problematisieren. Aber sobald es darum geht, ob daraus etwas Tieferes werden kann, stoße ich fast immer an eine Grenze.
Es gibt Momente, in denen ich gespürt habe, dass mehr da ist. Dass Zuneigung, vielleicht sogar Liebe im Raum stand. Aber dann kam der Satz, der mir die Luft nahm: „Für einen Mann könnte ich mich entscheiden.“ In diesem Satz steckt so viel mehr als eine Entscheidung. Er sagt mir: Du bist zweite Wahl. Du bist nett, aber nicht genug. Du bist B-Ware in einer Welt, die Männer immer noch als Norm behandelt. Für mich, als lesbische, autistische Transfrau, ist das ein Schlag, der tiefer geht, als viele verstehen. Ich will nicht zweite Geige sein, ich will nicht immer nur Option sein. Ich will erste Wahl sein, und das ohne „Aber“.
Ich habe nicht passiv gewartet. Ich habe gekämpft. Ich habe in Poly-Beziehungen ausgelotet, ob sich daraus mehr entwickeln kann. Ich habe versucht, ob Frauenfreundschaften zu etwas Tieferem werden können. Ich habe Worte gesucht, Gefühle erklärt, Hoffnungen ausgesprochen. Aber oft blieb es bei dem Versuch. Ich musste lernen, dass selbst mein ganzer Einsatz nicht reicht, wenn die Prioritäten auf der anderen Seite anders liegen. Es ist nicht so, dass ich nichts gebe. Es ist eher so, dass ich alles gebe und es trotzdem nicht genug ist.
Ich habe nicht nur einmal gehofft, dass aus Freundschaft mehr werden könnte. Ich habe es immer wieder versucht, habe Nähe aufgebaut, Gefühle gezeigt, Grenzen ausgelotet. Doch am Ende stand ich zu oft allein da. Jedes Mal, wenn ich dachte, dass sich eine Tür öffnen könnte, fiel sie wieder zu – manchmal leise, manchmal mit voller Wucht. Irgendwann blieb nur noch Leere zurück.
Seit dem Frühjahr 2025 spüre ich, wie diese Einsamkeit nicht nur seelisch, sondern auch körperlich an mir zehrt. Meine Gesundheit hat gelitten, weil ich die Abwesenheit von Nähe nicht mehr ausgleichen konnte. Für manche Menschen ist Zuneigung selbstverständlich, für mich ist sie überlebenswichtig – und genau deshalb reißt ihr Fehlen tiefe Wunden.
Ich habe aufgehört zu hoffen. Nicht, weil ich keine Sehnsucht mehr hätte, sondern weil die Enttäuschung jedes Mal schwerer wog als das kleine Aufflackern von Hoffnung. Für mich ist Nähe kein Bonus, kein Luxus, sondern das, was mir überhaupt erst Kraft gibt, im Alltag zu bestehen. Wenn sie fehlt, bleibt ein Loch zurück, das sich nicht mit Aktivismus, Arbeit oder Routinen füllen lässt.
Als autistische, lesbische Transfrau habe ich nur wenige Räume, in denen Beziehung wirklich möglich ist. Meine Intensität schreckt manche ab, meine Identität andere. Das macht Begegnungen seltener, langsamer, fragiler. Und genau deshalb ist es umso schmerzhafter, wenn auch diese wenigen Chancen wieder zerbrechen.
Berlin zwischen Freiheit und Leere
Berlin hat mir in den letzten Jahren vieles ermöglicht. Hier konnte ich sichtbar sein, auf Bühnen stehen, protestieren, laut werden. Ich habe Routinen aufgebaut, die mich durch die Reizflut bringen: Noise-Cancelling-Kopfhörer, klare Zeitfenster für Rückzug, Räume, in denen niemand fragt, warum ich schweige. Berlin hat mich befreit von der Enge kleinerer Orte, in denen jede Abweichung sofort auffällt.
Aber Berlin hat mir auch eine neue Form von Leere gezeigt. Ich kann vor Hunderten Menschen reden und am Abend doch allein einschlafen. Ich kann eine Demo anführen, Interviews geben, Texte schreiben und gleichzeitig spüren, dass mir niemand die Hand hält, wenn die Erschöpfung kommt. Aktivismus gibt mir Sinn, er hält mich lebendig – aber er ersetzt keine Nähe. Er kann nicht füllen, was in stillen Momenten fehlt.
Und genau in dieser Leere spüre ich die ganze Härte meiner Realität. Ich bin Autistin, also brauche ich Klarheit und Rückhalt. Ich bin lesbische Transfrau, also sind die Räume, in denen ich überhaupt echte Partnerschaft finden kann, schon kleiner. Ich kann nicht in chaotische Clubs, ich kann nicht im Smalltalk flirten, ich kann keine unklaren Signale interpretieren. Ich brauche Menschen, die bereit sind, meine Intensität auszuhalten. Menschen, die Nähe nicht dosieren, sondern teilen. Aber sie sind selten.
Darum fühlt sich mein Leben oft an wie ein Kalender voller Inseln. Hier eine Begegnung, da ein paar Tage mit einer Frau, die mir wichtig ist. Und danach wieder Wochen voller Leere. Ich weiß, wie es sich anfühlt, gesehen und gehalten zu werden und genau deshalb tut die Abwesenheit noch mehr weh. Jede Abreise, jedes Ende eines Besuchs trägt schon den Schatten des nächsten Alleinseins.
Fazit: Überleben statt kämpfen
Früher hat man mich als Lebenskämpferin gekannt. Die, die sich durchbeißt, alles organisiert, immer noch einen Weg findet. Die, die Rückschläge wegsteckt und trotzdem weitermacht. Diese Zeiten fühlen sich gerade vorbei an. Heute kämpfe ich nicht mehr darum, zu leben – ich kämpfe darum, zu überleben. Es ist kein heroischer Kampf, sondern ein leiser, müder, manchmal verzweifelter. Ich weiß nicht, ob ich es noch aushalte.
Was mich am meisten zermürbt, ist die Einsamkeit. Für viele Menschen ist Nähe selbstverständlich, sie fällt ihnen zu. Sie finden Partner*innen, sie haben Beziehungen, sie müssen nicht erklären, warum sie so sind, wie sie sind. Für mich ist diese Lebensrealität weit weg. Autismus allein macht es schon schwer, aber Autismus und Trans zusammen machen es zu einem Labyrinth. Die Räume, in denen ich überhaupt gesehen werde, sind kleiner. Die Chancen, in denen echte Partnerschaft möglich ist, sind seltener. Und je älter ich werde, desto stärker spüre ich: Als Transfrau werde ich nicht „einfach so“ schöner oder begehrter. Stattdessen wird alles härter, während die Kraft weniger wird.
Selbst bei Frauen, die sich offen bi nennen, erlebe ich immer wieder dasselbe Muster. Am Ende entscheiden sie sich für den Mann. Die weibliche Partnerin bleibt oft die zweite Auswahl, die B-Ware, selbst wenn die Verbindung tiefer, zärtlicher, ehrlicher ist. Für mich ist das ein doppelter Schlag. Ich weiß, dass ich eine Frau genauso glücklich machen kann wie ein Mann – auch sexuell, auch emotional. Und doch bleibt mir diese Rolle verwehrt. Ich schaue zu, wie andere eine Selbstverständlichkeit leben, die ich nie erreiche und das bricht etwas in mir.
Diese Mischung aus Identität, Erschöpfung und wiederholter Enttäuschung macht es kaum noch möglich, ein zufriedenes Leben zu finden. Für Menschen, die „nur“ neurodivers sind, mag das Leben kompliziert sein, aber es gibt trotzdem eine heteronormative Welt, in die sie passen. Für Menschen, die „nur“ trans sind, gibt es manchmal wenigstens einen Weg in eine feste Beziehung. Für mich, als lesbische, autistische Transfrau, ist beides zusammen wie eine doppelte Tür, die verschlossen bleibt.
Ich schreibe das, weil ich nicht mehr die Kraft habe, es zu beschönigen. Ich bin nicht mehr die, die unerschütterlich kämpft. Ich bin eine Transfrau, die an ihrer Einsamkeit zerreibt, die weiß, wie viel sie geben kann und die trotzdem nicht gewählt wird. Gerade fühlt es sich nicht mehr nach „Kämpfen, um zu leben“ an, sondern nach „Überleben, um nicht ganz zu verschwinden“.
Diese Erschöpfung bleibt nicht ohne Folgen für meinen Aktivismus. Ich bin Gründerin von Queermany, habe in Berlin die Ortsgruppe aufgebaut und war lange Vollzeitaktivistin. Und doch merke ich inzwischen, dass ich es nicht mehr schaffe, wirklich etwas zu machen. Man spürt es sofort, wenn eine Vollzeitaktivistin ausfällt und ich spüre es auch selbst. Ich sehe es nicht mehr ein, meine ganze Kraft für eine Gesellschaft einzusetzen, die nicht für mich da ist. Von Bewunderung und schönen Worten kann ich nicht leben. Ich brauche gelebte Nähe, Gewolltsein, ein Zuhause in Beziehungen. Das sind Dinge, die mir verwehrt bleiben, während ich Klatschen und Bewunderung bekomme – dieselbe hohle Anerkennung, die ich schon aus anderen Bereichen der Gesellschaft kenne, wie aus der Pflege, die nichts daran ändert, dass die Menschen darin verbrennen.
→ Im nächsten Teil: Was Nähe für mich bedeutet – und warum sie so selten ist.
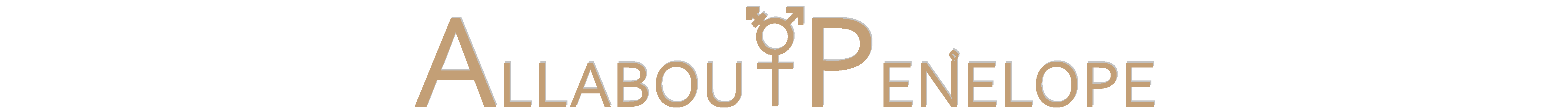
 Unterstütze meine Transition
Unterstütze meine Transition
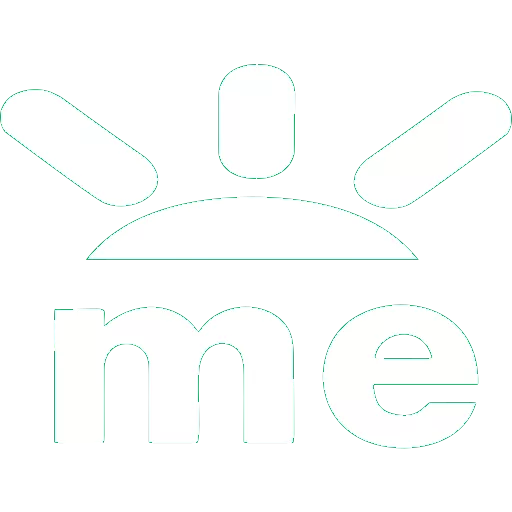 Spende für meine Repressionen
Spende für meine Repressionen